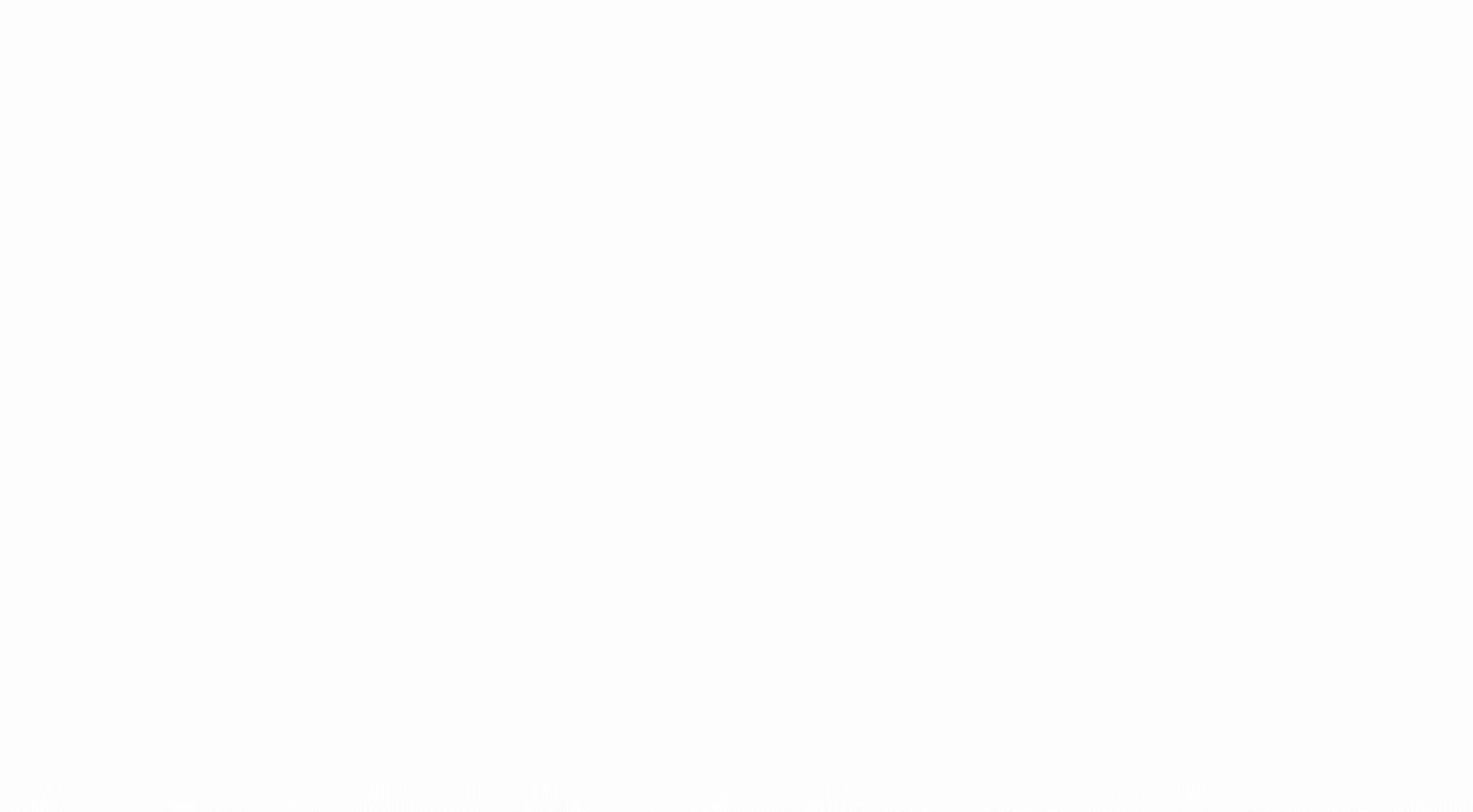Unternehmer im Mittelstand stehen häufig vor der Frage: „Was ist mein Unternehmen wert?“ Diese Frage ist branchenübergreifend von zentraler Bedeutung – sei es im Kontext einer Nachfolge eines Unternehmensverkaufs oder Finanzierungsoptionen. In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für Unternehmensbewertungen deutlich gewandelt. Der folgende Artikel beleuchtet, welche Einflussfaktoren die Bewertung mittelständischer Unternehmen bestimmen, wie sich das Bewertungsniveau zuletzt entwickelt hat und wagt einen Ausblick mit Prognosen für die kommenden Monate.
Einflussfaktoren für die Unternehmensbewertung im Mittelstand
Mehrere Faktoren bestimmen, wie hoch ein mittelständisches Unternehmen bewertet wird. Zu den wichtigsten Einflussgrößen gehören:
Zinsniveau und Konjunktur: Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld spielt eine entscheidende Rolle. Steigende Zinsen in den Jahren 2022 und 2023 erhöhten die Kapitalkosten (Abzinsungsfaktor) und drückten dadurch die Bewertungen vieler Unternehmen. So stieg etwa der für Bewertungen in Deutschland relevante IDW-Basiszinssatz infolge hoher Inflation bis Januar 2024 auf 2,75 % – den höchsten Wert seit 2014. Umgekehrt führt eine sinkende Inflation mit fallenden Leitzinsen zu Entlastung: 2024 begann die EZB, die Zinsen erstmals wieder zu senken, was die Finanzierungskosten verbilligte und tendenziell höhere Unternehmenswerte begünstigt. Gleichzeitig erschweren Konjunkturabschwächungen und Rezessionsängste die Einigung auf einen Kaufpreis – in unsicheren Zeiten tun sich Käufer und Verkäufer schwer, sich auf einen Unternehmenswert zu verständigen.
Kapitalmarkt und Investoren-Druck: Die Verfügbarkeit von Kapital und die Stimmung am Transaktionsmarkt beeinflussen das Bewertungsniveau erheblich. In den vergangenen Jahren saßen Finanzinvestoren (Private Equity) auf großen Kapitalbeständen (“Dry Powder”) und standen unter Druck, dieses Geld gewinnbringend zu investieren. Dieses Überangebot an kaufwilligen Investoren führte dazu, dass Wettbewerb um attraktive Targets entstand – was die Kaufpreise trieb. So zahlten Private-Equity-Fonds zuletzt im Schnitt höhere Multiples als strategische Käufer, was den Markt nach oben zog. Gleichzeitig haben sich seit Ende 2024 die Finanzierungsbedingungen wieder etwas verbessert (u.a. durch niedrigere Zinsen und wieder aufnahmefähigere Kreditmärkte), was ebenfalls höhere Kaufpreise ermöglicht. Allerdings kann eine Verschlechterung der Finanzierungslage (z. B. wenn Banken vorsichtiger werden) den Spielraum für hohe Bewertungen ebenso schnell wieder einengen.
Branchen- und Unternehmensspezifika: Branchentrends und die individuelle Situation des Unternehmens bleiben zentrale Werttreiber. In den letzten Jahren zeigten sich große Unterschiede zwischen den Sektoren. Resiliente Wachstumsfelder wie Technologie, Software, Medizintechnik oder Gesundheitswesen erzielten häufig hohe Bewertungsmultiples, befeuert durch starke Nachfrage der Investoren nach zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen. Auch Bereiche wie Erneuerbare Energien profitieren von einem Nachhaltigkeits-Boom und wurden mit hohen Preisen honoriert, wenngleich sich auch hier der Markt in 2024 und in 2025 stark beruhigte. Demgegenüber sahen sich konjunkturabhängige oder unter Druck stehende Branchen (z. B. Teile des Einzelhandels oder Automobilzulieferer) mit Bewertungsabschlägen konfrontiert und wurden teils als Distressed-Cases verkauft. Letztlich fließen auch klassische Faktoren wie Umsatz- und Gewinnentwicklung, Marktposition, Wettbewerbsvorteile sowie die Größe des Unternehmens in die Bewertung ein – diese können je nach Branche und Geschäftsmodell sehr unterschiedlich ausfallen.
Nachhaltigkeit und Digitalisierung: Nicht-finanzielle Faktoren gewinnen an Bedeutung. Unternehmensbewertungen verschieben sich von einem rein zahlengetriebenen Blick hin zu einer ganzheitlicheren Perspektive, die auch ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), die digitale Transformation und die Anpassungsfähigkeit eines Geschäftsmodells berücksichtigt. Unternehmen mit überzeugender Nachhaltigkeitsstrategie oder digitalen Innovationsvorsprung können einen Bewertungsaufschlag erzielen, da Investoren hierin zukünftiges Potenzial sehen. Umgekehrt führen technologische Disruption oder Versäumnisse bei Nachhaltigkeit zunehmend zu Abschlägen in der Bewertung. Kurz gesagt: Weiche Faktoren – vom Markenimage über die Belegschaft bis zur Klimastrategie – spielen eine immer größere Rolle im mittelständischen Unternehmenswert.
Entwicklung der Bewertungsniveaus in den letzten Jahren
Die vergangenen Jahre waren von erheblichen Schwankungen im M&A-Markt und damit auch im Bewertungsniveau mittelständischer Unternehmen geprägt. Bis 2021 erlebte der Markt einen langjährigen Aufschwung: Angetrieben durch billiges Geld, hohe Liquidität und optimistische Wachstumsaussichten stiegen die Unternehmenswerte stark. Viele Deals wurden zu historisch hohen Multiples abgeschlossen. Ein Indikator dafür ist der europäische Argos Mid-Market Index, der die mittleren Kaufpreis-Multiples für nicht-börsennotierte Mittelständler misst. Dieser Index erreichte auf dem Höhepunkt Werte von über dem 11-Fachen des EBITDA – ein außerordentlich hohes Niveau, das die Boomphase vor 2022 widerspiegelt.
Ab Ende 2022 schlug das Pendel jedoch um. Die Kombination aus abrupt steigenden Zinsen, geopolitischen Krisen und Konjunktursorgen führte zu einem Stimmungsumschwung. Käufer wurden vorsichtiger, und viele Unternehmen spürten Gegenwind durch höhere Kosten (z. B. Energie, Material) sowie Unsicherheiten etwa infolge des Ukraine-Kriegs. In dieser Phase gerieten die Bewertungen unter Druck: Der Argos-Index fiel innerhalb von drei Jahren kontinuierlich von 11,6× auf nur noch 8,9× EBITDA. Deals zogen sich länger hin, und so manche Verkaufstransaktion wurde verschoben, da die Preisvorstellungen zwischen Verkäufern und Käufern auseinander gingen. Die generelle Stimmung auf den Vorstandsetagen und bei Finanzinvestoren war 2023 „sehr verhalten“ – ein Klima, in dem deutliche Bewertungsabschläge häufiger wurden. In unsicheren Zeiten zahlten strategische Käufer tendenziell weniger und suchten verstärkt nach günstigen Gelegenheiten, während finanzstarke Investoren zwar Geld hatten, aber ebenfalls selektiver agierten.
Im Jahr 2024 zeigte sich dann eine spürbare Erholung am Transaktionsmarkt – und mit ihr eine Wiederbelebung der Bewertungen. Dank rückläufiger Inflation und ersten Zinssenkungen verbesserten sich die Finanzierungsbedingungen, und die M&A-Aktivität im Mittelstand zog wieder an. Im dritten Quartal 2024 kletterte der Argos-Index schließlich auf ein Median-Multiple von 9,5× EBITDA – der erste Anstieg nach drei Jahren Rückgang. Private-Equity-Fonds traten nun wieder aggressiver als Käufer auf und zahlten für qualitativ hochwertige Unternehmen deutlich höhere Preise (durchschnittlich rund 10,1× EBITDA), was den Anstieg der Gesamtmarktbewertung maßgeblich antrieb. Strategische Käufer erhöhten ihre Multiples nur leicht (auf ca. 8,8×), profitierten aber ebenfalls von der insgesamt verbesserten Lage. Die Kaufpreisspanne zwischen hoch und niedrig bewerteten Deals begann sich etwas zu normalisieren: Der Anteil an Transaktionen mit extrem niedrigen Multiples unter 7× ging im Zuge der Markterholung deutlich zurück.
Zum Jahresende 2024 hin setzte sich dieser positive Trend fort – der Argos-Index stieg im 4. Quartal weiter auf etwa 9,8× EBITDA. Unterstützt wurde dies durch einen Anstieg des Transaktionsvolumens (≈13 % mehr Deals 2024 vs. 2023) sowie ein wieder erstarktes LBO-Geschäft. Gleichzeitig profitierte der Markt von sinkenden Kapitalkosten, da die Inflation in Richtung 2 % fiel und weitere Zinssenkungen der EZB erwartet wurden. Allerdings warnten Experten bereits, dass das nach wie vor fragile makroökonomische Umfeld – schwaches Wirtschaftswachstum, politische Unsicherheiten und geopolitische Spannungen – die Erholung begrenzt und ein vollständiger Boom ausbleibt.
Tatsächlich zeigte sich im ersten Halbjahr 2025 eine leichte Abkühlung: Neue Unsicherheitsfaktoren (beispielsweise aufkeimende internationale Handelskonflikte) drückten erneut auf die Stimmung. Infolgedessen sank der Argos-Bewertungsindex bis zum zweiten Quartal 2025 wieder leicht auf rund 9,2× EBITDA. Diese Korrektur verdeutlicht, dass die Markterholung zerbrechlich ist. Insbesondere strategische Käufer agierten zurückhaltender, wohingegen Finanzinvestoren ihre Bewertungsniveaus weitgehend halten konnten. Der Markt bleibt also volatil – kleine Verschiebungen im Umfeld können sich schnell in den Mittelstandsbewertungen niederschlagen.
Prognosen: Wohin entwickeln sich die Unternehmensbewertungen?
Wie geht es weiter? Auch wenn niemand die Zukunft genau vorhersagen kann, lassen sich auf Basis der aktuellen Daten und Trends einige Prognosen für die mittelständischen Unternehmensbewertungen formulieren:
Nachhaltigkeit und Digitalisierung: Nicht-finanzielle Faktoren gewinnen an Bedeutung. Unternehmensbewertungen verschieben sich von einem rein zahlengetriebenen Blick hin zu einer ganzheitlicheren Perspektive, die auch ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), die digitale Transformation und die Anpassungsfähigkeit eines Geschäftsmodells berücksichtigt. Unternehmen mit überzeugender Nachhaltigkeitsstrategie oder digitalen Innovationsvorsprung können einen Bewertungsaufschlag erzielen, da Investoren hierin zukünftiges Potenzial sehen. Umgekehrt führen technologische Disruption oder Versäumnisse bei Nachhaltigkeit zunehmend zu Abschlägen in der Bewertung. Kurz gesagt: Weiche Faktoren – vom Markenimage über die Belegschaft bis zur Klimastrategie – spielen eine immer größere Rolle im mittelständischen Unternehmenswert.
Belebung der M&A-Aktivität erwartet: Viele Anzeichen deuten darauf hin, dass 2025 eine rege Transaktionsdynamik im Mittelstand bringt. Nach dem leichten „Deal-Stau“ der Vorjahre rechnen Marktbeobachter mit bis zu 20 % mehr kleineren und mittleren Unternehmenstransaktionen im Vergleich zu 2024. Eine höhere Anzahl an Deals bedeutet tendenziell auch mehr Wettbewerb um gute Targets – was Bewertungen stützen dürfte. Die Notwendigkeit zu wachsen (Stichwort: Skaleneffekte) und der Druck zur digitalen Transformation zwingen viele Mittelständler entweder zu Zukäufen oder machen sie selbst zu Übernahmekandidaten. Dieses strategische Momentum dürfte die Nachfrage nach soliden mittelständischen Firmen hochhalten.
Stabilisierung durch finanzielle Rahmenbedingungen: Die finanzwirtschaftlichen Eckdaten entwickeln sich vorsichtig positiv. Die Inflation befindet sich (zumindest in Europa) auf dem Rückzug, und weitere Zinssenkungen durch die Notenbanken liegen im Bereich des Möglichen. Sinken die Zinsen weiter, reduziert dies die Kapitalkosten und erhöht mathematisch den Barwert zukünftiger Erträge – ein klarer Bewertungstreiber. Zudem verbessert ein lebhafter Fremdkapitalmarkt (Banken und Debt Funds zeigen wieder mehr Appetit, Kredite zu vergeben) die Finanzierung von Übernahmen. All das spricht dafür, dass tragfähige Unternehmen auch künftig vernünftige bis hohe Multiples erzielen können. Allerdings handelt es sich um einen langsamen Prozess: Solange das gesamtwirtschaftliche Umfeld von mauem Wachstum und Risiken geprägt bleibt, ist nur mit moderat steigenden Bewertungen zu rechnen.
Unsicherheiten bleiben Risikofaktor: Trotz aller hoffnungsvollen Signale bleibt der Markt fragil. Geopolitische Spannungen (z. B. handelspolitische Konflikte oder regionale Krisen) können das Vertrauen jederzeit erschüttern. Auch interne Herausforderungen – etwa politische Instabilitäten in einzelnen Ländern oder ein wieder anziehender Inflationsdruck – könnten Investoren verunsichern. Dieser Cocktail an Unsicherheiten führt dazu, dass Käufer nach wie vor wählerisch bleiben und nur für wirklich überzeugende Targets Höchstpreise zahlen. Insgesamt ist damit zu rechnen, dass die aktuell noch relativ hohen Kaufpreise unter Druck geraten könnten, falls die Unternehmensgewinne stagnieren oder rückläufig sind. Viele Mittelständler spüren bereits eine abnehmende Dynamik in ihrem Geschäft – sinkende Erträge würden die Bewertungsgrundlage schmälern und die Multiples drücken. Kurz: Die Ertragsperspektiven des Targets müssen stimmen, sonst werden Abschläge gefordert.
Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit: Die Erfahrung zeigt, dass in unsicheren Phasen die Investoren-Ansprüche steigen. Für die kommenden Monate ist zu erwarten, dass insbesondere qualitativ hochwertige Unternehmen – etwa mit krisenresistenten Geschäftsmodellen, technologischer Führungsposition oder starker Marke – weiterhin hohe Bewertungen erzielen. Private-Equity-Fonds haben nach wie vor reichlich Kapital und zahlen Top-Preise vor allem für „Perlen“, die auch in Abschwungphasen robust sind. Unternehmen, die zudem in Trendfeldern wie Digitalisierung oder ESG punkten, können mit regem Interesse rechnen. Durchschnittliche Unternehmen ohne besonderen USP hingegen werden sich vermutlich mit zurückhaltenderen Geboten abfinden müssen. Dieser Qualitätsfokus dürfte die Schere am Markt verstärken: Top-Firmen erhalten Multiples am oberen Ende der Skala, während schwächere Firmen deutliche Bewertungsabschläge hinnehmen müssen.

Zusammenfassend ist ein vorsichtig optimistischer Ausblick angebracht. Die Talsohle der Bewertungsentwicklung scheint durchschritten, doch ein fulminanter neuer Boom ist unwahrscheinlich. Vielmehr deuten die Prognosen auf einen fragilen Aufschwung hin: Es werden sich Chancen ergeben, starke Unternehmen zu vernünftigen Preisen zu erwerben oder zu verkaufen, jedoch bleibt der Markt anfällig für Störungen. Für Unternehmer bedeutet das, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen und sich flexibel aufzustellen. Mit realistischen Preisvorstellungen, soliden Geschäftszahlen und einer klar kommunizierten Zukunftsstrategie lassen sich selbst in bewegten Zeiten attraktive Unternehmenswerte erzielen – beraten von erfahrenen M&A-Experten, die helfen, alle Einflussfaktoren richtig einzuordnen. Denn die Wertfindung im Mittelstand bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe, die fundierte Analyse und Fingerspitzengefühl erfordert – heute mehr denn je.
Die im Artikel genannten Fakten und Zahlen basieren auf aktuellen Marktstudien und Expertenanalysen, darunter der Argos Mid-Market Index (Stand Q2 2025), Branchenbeobachtungen renommierter Beratungshäuser sowie Insights aus dem Kleeberg Jahresrückblick Unternehmensbewertung 2024.
Jahresrückblick 2024: Entwicklungen in der Unternehmensbewertung -Valuation Kleeberg
Outlook for the German M&Amarket in 2025
Mid-market Argos Index® for thesecond quarter of 2025 | Argos

.svg.avif)