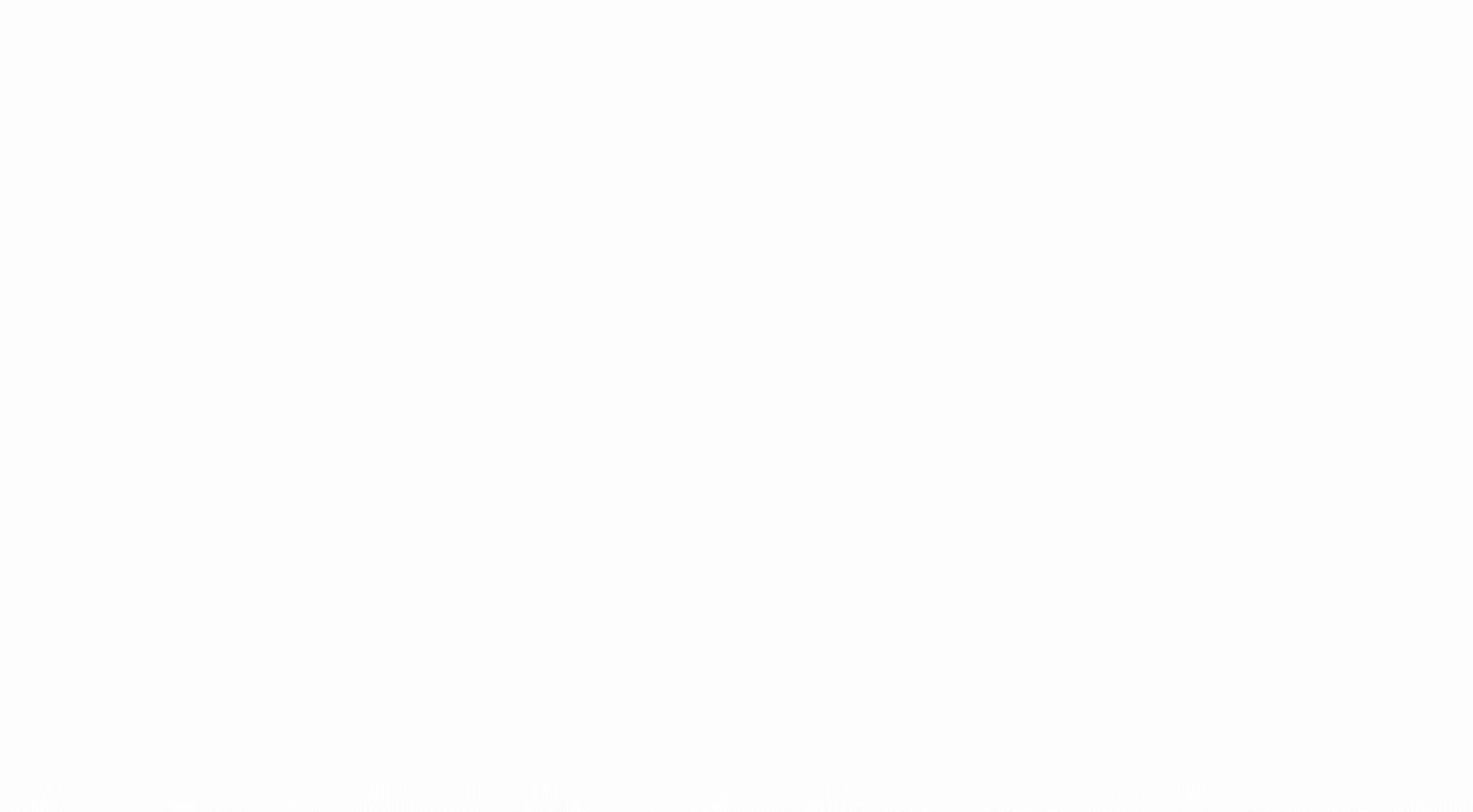1. Executive Summary
Die Ingenieur- und Planungsbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz erlebt aktuell einen tiefgreifenden strukturellen Wandel. Getrieben von Digitalisierung, ESG-Regulatorik und einem massiven demografischen Druck verändern sich Geschäftsmodelle und Eigentümerstrukturen in einer Branche, die lange Zeit stabil und kleinteilig organisiert war.
Viele Ingenieurbüros stehen heute vor einem doppelten Transformationsdruck: Sie müssen ihre technologischen und organisatorischen Prozesse modernisieren (BIM, digitale Kollaboration, KI-gestützte Planung) und gleichzeitig Nachfolgelösungen finden, da der Altersdurchschnitt der Inhaber über 55 Jahre liegt. Damit entsteht ein außergewöhnliches Momentum für Konsolidierung und professionelles Wachstum – sowohl im Hochbau als auch in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und im Infrastrukturbau.
1.1 Strukturelle Treiber
Die Regulatorik sorgt für klare Leitplanken:
- BIM-Verpflichtung im Bundesbau bis 2027,
- HOAI-Novelle (voraussichtlich 2025/26) mit stärkerer Digitalisierung und Preisflexibilisierung,
- EU-Gebäuderichtlinie (EPBD-Recast) mit Vorgaben zu Sanierungsfahrplänen, Energieeffizienz und „Zero Emission Buildings“.
Diese Vorgaben zwingen zu Investitionen in IT, Prozessstandardisierung und Kompetenzerweiterung – ein Umfeld, das große, gut kapitalisierte Unternehmensverbünde bevorteilt.
Gleichzeitig bleibt die Nachfrage robust: Öffentliche Infrastrukturprogramme in Deutschland, Österreich und der Schweiz sichern über Jahre hinweg hohe Grundauslastung. Deutschland investiert 2025 rund 22 Mrd. € in Infrastruktur, davon 10,5 Mrd. € in die Schiene. Der österreichische ÖBB-Rahmenplan umfasst 21 Mrd. € bis 2029, die Schweiz investiert 16 Mrd. CHF (2025–2028) in Bahninfrastruktur. Im Hochbau sorgen ESG-getriebene Sanierungen, Energieeffizienzprogramme und kommunale Bauinitiativen für anhaltend stabile Projektvolumina.
1.2 Erste Welle der Konsolidierung
Nach Jahrzehnten der Zersplitterung formiert sich derzeit die erste ernstzunehmende Konsolidierungswelle im Ingenieursektor. Neben internationalen Strategen wie WSP oder Drees & Sommer prägen vor allem Private-Equity-gestützte Plattformen die Dynamik im Mittelstand:
Encoviva (Greenpeak Partners): fokussiert auf Hochbau und Generalplanung; Ziel ist der Aufbau einer integrierten Gruppe aus spezialisierten Ingenieurbüros in Statik, TGA, Bauphysik und Projektmanagement.
Orara (Auctus Capital Partners): Buy-and-Build-Strategie im Hochbau mit Fokus auf Bauingenieurwesen, Tragwerksplanung und TGA; bündelt mittelständische Ingenieurbüros in Süddeutschland und Österreich.
Treysta Group: konzentriert sich auf Infrastruktur- und Tiefbauplanung; adressiert die großen öffentlichen Investitionsprogramme in Schiene, Wasser und Energie sowie den steigenden Bedarf an nachhaltiger, digital unterstützter Planung im kommunalen und industriellen Umfeld.
Alva Capital: gegründet von einem der Köpfe hinter Treysta, zielt auf ein Buy-and-Build im Bereich technische Gebäudeausrüstung (TGA) im Hochbau; fokussiert auf Digitalisierung, Energieeffizienz und integrale Planung sowie den Zusammenschluss erfolgreicher Fachplanungsbüros zu einer mittelstandsnahen Gruppe mit gemeinsamen Ressourcen in Personal, Einkauf und Administration.
Diese Plattformen bilden die Vorreiter einer breiteren Konsolidierungsbewegung: Sie schaffen regionale Kompetenzhubs (z. B. Süd, West, AT, CH) und bündeln spezialisierte Ingenieurbüros unter einer gemeinsamen Holdingstruktur mit zentralem Backoffice, Recruiting, IT und Ausschreibungsmanagement. Damit entstehen erstmals in größerem Stil skalierbare Unternehmensverbünde in einem Markt, der bislang stark von Einzelpraxen und Partnerschaften geprägt war.
1.3 Wirtschaftliche Logik
Die wirtschaftliche Attraktivität des Sektors beruht auf mehreren Faktoren:
- Hohe Grundnachfrage durch öffentliche Bauprogramme und ESG-getriebene Sanierungen,
- Wiederkehrende Umsätze über langlaufende Projekte und Serviceverträge,
- Solide Margen (typisch 10–15 % EBIT im Hochbau),
- Geringe Konjunktursensitivität, da Planungsleistungen in allen Bauzyklen benötigt werden,
- Digitalisierungshebel (BIM, KI, Prozessautomatisierung), die Effizienzsteigerungen und Skalierbarkeit erlauben.
Bewertungen liegen aktuell im Bereich 6,5–9,0× EBITDA, mit Premium-Multiples für digital reife, wachstumsfähige Firmen mit stabiler öffentlicher Auftragsbasis. Family Offices und spezialisierte Fonds konkurrieren zunehmend mit klassischen PE-Fonds um attraktive Targets, da der Sektor resiliente Cashflows und ESG-Kompatibilität bietet.
1.4 Ausblick
Die Dynamik im Ingenieursektor wird in den kommenden Jahren anhalten. Digitalisierung, ESG-Anforderungen und Fachkräftemangel werden kleinere Büros weiter unter Druck setzen, während größere Gruppen ihre Position durch Skaleneffekte und Markenstärke ausbauen. Gleichzeitig schaffen die Investitionsprogramme im öffentlichen Bereich langfristige Planungssicherheit und Auftragsstabilität.
Für mittelständische Unternehmer ergeben sich daraus zwei zentrale Handlungsoptionen:
- Strategischer Zusammenschluss oder Verkauf an eine wachsende Plattform, um Nachfolge, Kapital und Digitalisierung zu sichern,
- Eigene Konsolidierungsstrategie, um selbst regionaler Player oder Kompetenzführer zu werden.
2. Marktstruktur & Nachfrage
2.1 Gesamtmarkt und wirtschaftliche Bedeutung
Ingenieurbüros zählen zu den tragenden Säulen der deutschen Bau- und Immobilienwirtschaft. Mit einem jährlichen Gesamtumsatz von geschätzt €55–60 Mrd. in der DACH-Region (davon über 75 % in Deutschland) bilden sie die Planungs- und Steuerungsebene zwischen öffentlicher Hand, Bauindustrie und Immobilienentwicklern. Rund 50.000 Ingenieur- und Architekturbüros in Deutschland beschäftigen zusammen über 300.000 Fachkräfte – von Tragwerksplanern und TGA-Spezialisten bis hin zu Projektsteuerern, Bauphysikern und Prüfingenieuren.
Trotz ihrer gesamtwirtschaftlichen Relevanz ist die Branche weiterhin hoch fragmentiert: Der Großteil der Büros erwirtschaftet weniger als €5 Mio. Umsatz p.a., viele sind inhabergeführt und lokal organisiert. Diese Struktur sorgt für Nähe zu den Kunden, limitiert jedoch Investitionsfähigkeit, Skalierbarkeit und Digitalisierungsgeschwindigkeit.
In Summe lässt sich der Markt in drei große Segmente unterteilen:
- Hochbau und Gebäudeplanung (inkl. TGA, Statik, Bauphysik) – etwa 55 % Marktanteil,
- Infrastruktur- und Tiefbauplanung (Straßen, Bahn, Wasser, Energie) – etwa 30 %,
- Beratende Ingenieurdienstleistungen (Projektsteuerung, Controlling, Umwelttechnik) – rund 15 %.
In allen drei Bereichen wächst der Druck, Prozesse zu digitalisieren, Nachhaltigkeit nachzuweisen und Fachkräfte zu gewinnen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen öffentlicher Auftraggeber an Dokumentation, Nachverfolgung und Transparenz – Faktoren, die größere Unternehmensverbünde begünstigen.
2.2 Konjunktur und Investitionsumfeld
Nach den stark inflationären Jahren 2022–2023 hat sich die Bauwirtschaft 2024/25 in einem Übergangsmodus stabilisiert. Während der private Wohnungsbau weiterhin unter hohen Finanzierungskosten leidet, ziehen öffentliche und gewerbliche Projekte spürbar an. Der Bauindex der Bundesingenieurkammer zeigt seit Mitte 2024 eine leichte Erholung, getragen von Energie- und Infrastrukturprojekten.
Besonders im öffentlichen Bereich wirkt sich das neue Sondervermögen „Klimaschutz und Transformation“ (KTF) sowie das Sondervermögen für Bundeswehr und Infrastrukturprojekte auf die Nachfrage nach Ingenieurleistungen aus. Die Bundesregierung plant bis 2030 über €600 Mrd. an Förder- und Investitionsmitteln in Klimaschutz, Energieeffizienz, Verkehr und Infrastruktur zu lenken. Davon sollen allein im Zeitraum 2025–2027 mehr als €45 Mrd. in Verkehrswege, Brücken, Bahnstrecken, Wasserstraßen und Energieinfrastruktur fließen.
Diese öffentlichen Programme wirken als konjunkturstabilisierende Anker, insbesondere für Ingenieurbüros mit Fokus auf Tiefbau, Infrastrukturplanung und energetische Gebäudesanierung. Auch Landesinvestitionsgesellschaften und kommunale Bauämter setzen zunehmend auf externe Ingenieurleistungen, da interne Planungsressourcen knapp sind.
Parallel wächst der Bedarf im gewerblichen Hochbau: Unternehmen modernisieren Bestandsgebäude, errichten energieeffiziente Logistik- und Produktionsflächen und investieren in nachhaltige Büro- und Forschungsbauten. Hier fungieren Ingenieurbüros als technologische Schnittstelle zwischen Architektur, ESG-Beratung und Bauausführung – ein Tätigkeitsfeld mit steigenden Margen.
2.3 Hochbau-Segment: Nachhaltigkeit, Energie und Fachkräftemangel
Der Hochbau bleibt das volumenstärkste Segment im Ingenieurwesen, aber auch das herausforderndste.
Die Nachfrage verschiebt sich zunehmend von Neubauprojekten zu Sanierungen und Modernisierungen. Hintergrund sind:
- EU-Vorgaben zur CO₂-Reduktion und Gebäudeeffizienz (EPBD-Recast),
- nationale Programme wie BEG (Bundesförderung effiziente Gebäude),
- und die geplante Sanierungspflicht für Nichtwohngebäude ab 2030.
Damit wird der Fokus von „Planung neuer Flächen“ auf „Transformation bestehender Gebäude“ gelenkt. Ingenieurbüros mit Kompetenzen in Energieberatung, Gebäudeautomation, TGA, Bauphysik und Lebenszyklusanalyse profitieren überproportional.
Digitalisierung als Wettbewerbsfaktor:
Seit 2023 ist die Arbeit mit Building Information Modeling (BIM) bei öffentlichen Hochbauprojekten Standard. Bis 2027 soll sie in allen Bundesprojekten verbindlich werden. BIM verändert Planungsprozesse grundlegend: von linearen Abfolgen hin zu vernetzten, simultanen Prozessen mit 3D-/5D-Datenmodellen, Kostenverfolgung und Nachtragsmanagement.
Unternehmen, die BIM vollständig integriert haben, erzielen laut Branchenbefragungen bis zu 20 % Effizienzgewinn in Planung und Koordination – ein wesentlicher Margenfaktor.
Fachkräfte als Engpass:
Der größte Wachstumshemmer bleibt der Personalmangel. Laut ZDI NRW fehlen allein im Ingenieurbau bis 2030 über 50.000 qualifizierte Fachkräfte, besonders in den Bereichen TGA, Bauphysik und Tragwerksplanung. Größere Unternehmensgruppen können hier durch zentrale HR-Programme, Ausbildungspartnerschaften und eigene Akademien gegensteuern – ein zentraler Treiber für Buy-&-Build-Strategien.
2.4 Infrastruktur & Tiefbau: Wachstum durch staatliche Investitionen
Der Infrastruktur- und Tiefbausektor befindet sich in einem mehrjährigen Investitionshoch. Nach Jahren des Sanierungsstaus fließen erhebliche öffentliche Mittel in Verkehrswege, Wasserwirtschaft und Energieinfrastruktur.
Deutschland:
- Im Bundeshaushalt 2025 sind über €22 Mrd. an Infrastrukturinvestitionen vorgesehen.
- Schwerpunkte: Schienenwege (Deutsche Bahn Infrastruktur, >€10,5 Mrd.), Brückensanierungen, Wasserstraßen und Energietransportnetze.
- Das Sondervermögen der Bundesregierung ergänzt diese Mittel gezielt, um Transformations- und Nachhaltigkeitsprojekte zu beschleunigen – etwa Elektrifizierung von Bahnstrecken, Ladeinfrastruktur und Wasserstoffnetze.
- Die Nationale Wasserstoffstrategie (Update 2023) sieht zudem bis 2030 Investitionen von über €18 Mrd. in Planung, Transport und Speicherung vor.
Österreich:
- Der ÖBB-Rahmenplan 2024–2029 umfasst ein Rekordvolumen von €21 Mrd., insbesondere für Hochleistungsstrecken und Bahnhofsmodernisierungen.
- Parallel investieren Bund und Länder in Wasserbau und Hochwasserschutz (u. a. Donau- und Mur-Projekte).
Schweiz:
- Das Parlament hat für die Periode 2025–2028 ein Infrastrukturprogramm über 16,4 Mrd. CHF beschlossen (Nationalstrassen und Bahn).
- Ergänzt wird es durch das Klimaprogramm Gebäudesanierung mit 3 Mrd. CHF Fördervolumen.
Diese Projekte sichern die Grundauslastung vieler Ingenieurbüros langfristig. Besonders gefragt sind Spezialkompetenzen in Verkehrswegebau, Tunnelbau, Wasserbau, Umwelttechnik und Energieinfrastruktur. Unternehmen mit Expertise in nachhaltigen Materialien, ressourcenschonender Bauweise oder integraler Planung gewinnen Ausschreibungen zunehmend häufiger.
2.5 Ausblick: Stabile Nachfrage, aber steigende Anforderungen
Die Marktperspektive für Ingenieurbüros im DACH-Raum bleibt grundsätzlich positiv, jedoch mit zunehmender Polarisierung:
- Wachstumschancen bestehen für digital affine, spezialisierte und professionell organisierte Büros.
- Margendruck trifft hingegen kleinere, personalabhängige Büros ohne Skaleneffekte oder Nachfolgestrategie.
Die kommenden Jahre werden stark von drei Leitlinien geprägt:
- Öffentliche Investitionen aus Sondervermögen und ESG-Programmen sichern stabile Grundauslastung.
- Digitalisierung & Automatisierung schaffen Effizienz und Skalierbarkeit – Voraussetzung für Margenstabilität.
- Konsolidierung & Kooperation werden zu zentralen Erfolgsstrategien, um Nachfolge, Fachkräfte und Kapital zu sichern.
Damit steht die Ingenieurbranche vor einer strukturellen Neuordnung: weg vom Einzelbüro, hin zu professionellen, technologiegetriebenen Unternehmensverbünden. Die Marktnachfrage bleibt hoch – aber sie verlangt zunehmend Systemfähigkeit statt Einzelkompetenz.
3. Konsolidierung & M&A-Trends im Ingenieurwesen
3.1 Ausgangslage: Vom Partnerbüro zum Plattformmodell
Die Ingenieurbranche, traditionell von Partnerschaften und Einzelgesellschaften geprägt, tritt in eine neue Konsolidierungsphase ein. Noch bis 2020 bestand der Markt überwiegend aus unabhängigen, regional verankerten Büros mit wenigen Dutzend Mitarbeitern. Heute verändert sich dieses Bild rasant:
In kurzer Zeit sind mehrere Private-Equity-gestützte Plattformen entstanden, die den Markt gezielt aufrollen – vergleichbar mit der Entwicklung, die die Steuerberatungs- und Umwelttechnikbranche bereits hinter sich hat.
Hintergrund ist eine strukturelle Schieflage zwischen Nachfolgebedarf, Investitionsdruck und wachsender Komplexität:
- Der Altersdurchschnitt der Inhaber liegt bei über 55 Jahren.
- Digitalisierung, BIM und ESG-Berichterstattung erfordern Investitionen, die viele Einzelbüros überfordern.
- Öffentliche Auftraggeber verlangen zunehmend Zertifizierungen, IT-Sicherheit und Skalierbarkeit – Anforderungen, die große Verbünde besser erfüllen können.
Damit entsteht ein ideales Umfeld für M&A-Aktivitäten: Kapitalstarke Investoren bieten Nachfolgelösungen, bündeln Kompetenzen und professionalisieren Prozesse.
3.2 Die neue Buy-and-Build-Generation: Strategien und Akteure
In den letzten drei Jahren hat sich eine erste Konsolidierungswelle mit klaren Profilen herausgebildet. Sie unterscheidet sich von klassischen Fusionen durch ihre strategische Klarheit, langfristige Skalierungsziele und hohen Professionalisierungsgrad in Integration und Governance.
1. Encoviva (gegründet von Greenpeak Partners)
Fokus: Hochbau und Generalplanung
Strategie: Aufbau einer integrierten Gruppe von Ingenieur- und Planungsbüros mit Schwerpunkten in Statik, Bauphysik, TGA und Projektmanagement.
Struktur: Plattform mit zentralisiertem Backoffice (Finance, HR, IT) und dezentraler operativer Verantwortung.
Ziel: Effizienz durch Standardisierung und gemeinsame Markenpositionierung als integraler Generalplaner für ESG- und Sanierungsprojekte.
2. Orara (Auctus Capital Partners)
Fokus: Hochbau und Tragwerksplanung im Mittelstand
Strategie: Buy-and-Build in Süddeutschland und Österreich.
Besonderheit: Betonung auf Partnerschaftlichkeit – lokale Marken bleiben erhalten, werden aber durch zentrale Strukturen (z. B. BIM-Academy, Recruiting) gestärkt.
Ziel: Marktführer in Statik und Bauplanung mit europaweiter Kompetenz im Bestandbau.
3. Treysta Group
Fokus: Infrastruktur- und Tiefbauplanung (Verkehr, Energie, Wasser)
Strategie: Aufbau eines europäischen Ingenieurnetzwerks im öffentlichen Infrastruktur-Segment.
Besonderheit: 2024 Einstieg eines US-amerikanischen Nachhaltigkeitsfonds zur Wachstumsfinanzierung; starke ESG-Ausrichtung, dezentrale Organisationsstruktur und klare Positionierung als langfristiger Partner öffentlicher Auftraggeber im Rahmen des staatlichen Sondervermögens für Infrastrukturprojekte.
4. Alva Capital
Fokus: Technische Gebäudeausrüstung (TGA) und Energieeffizienz im Hochbau; dressiert die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen, digital vernetzten Gebäuden und integraler Fachplanung
Gründer: Ein ehemaliges Mitglied des Treysta-Managementteams
Strategie: Buy-and-Build im TGA-Segment mit klarem Digitalisierungs-, Automatisierungs- und ESG-Fokus; Zusammenschluss erfolgreicher Fachplanungsbüros (Elektro, HKLS, Gebäudeautomation, Brandschutz) zu einer mittelstandsnahen Gruppe mit zentralen Ressourcen in Personal, Einkauf und Administration.
Ziel: Aufbau einer neuen, zukunftsorientierten TGA-Unternehmensgruppe, die Effizienz, Energieeinsparung und intelligente Gebäudetechnik vereint – von der Planung bis zum Betrieb.
Diese vier Plattformen bilden die Vorreiter einer neuen Engineering-Industrie:
Sie verbinden Kapital, Technologie und Unternehmertum und schaffen erstmals skalierbare Strukturen in einem Markt, der bislang aus Einzelfirmen bestand.
Neben diesen Kernplattformen sind auch strategische Käufer aktiv:
- Drees & Sommer, WSP und Dorsch / RSBG konsolidieren gezielt kleinere Fachplaner, um ihre regionale Dichte zu erhöhen.
- Family Offices prüfen gezielte Beteiligungen im Nachhaltigkeits- und Infrastrukturbereich.
3.3 Bewertungsniveaus und Deal-Dynamik
Die Bewertungsmultiples für Ingenieurbüros im DACH-Raum bewegen sich aktuell im Bereich von 6,5 – 9,0 × EBITDA, abhängig von Größe, Spezialisierung und Digitalisierungsgrad.
Premium-Multiples (8,5–9,5×) werden für Büros mit
- stabiler öffentlicher Auftragsbasis,
- ausgereiftem BIM-/ERP-Setup und
- starker Führungsmannschaft gezahlt.
Standard-Multiples (6–7×) gelten für solide, inhabergeführte Mittelständler mit stabilen, aber noch nicht digitalisierten Strukturen.
Deals unter 5× sind zunehmend selten, da auch kleinere Unternehmen aufgrund der hohen Nachfrage nach Nachfolgelösungen einen Mindestwert realisieren können.
Dealvolumen:
Seit 2023 ist die Zahl abgeschlossener Transaktionen um rund 30 % gestiegen. Besonders aktiv sind Plattformen, die Clusterstrategien verfolgen – also mehrere kleinere Zukäufe in derselben Region oder Spezialisierung, um kritische Größe zu erreichen.
Finanzierungsumfeld:
Die Zinssenkungen der EZB im Sommer 2025 haben die Kosten für Akquisitionsfinanzierungen spürbar reduziert.
Debt-Funds zeigen wieder verstärkt Appetit auf kleinere LBO-Transaktionen im Bereich €5–20 Mio. Enterprise Value.
Das Zusammenspiel aus reichlich verfügbarem Kapital, hohem Nachfolgebedarf und solider Nachfragebasis führt zu einem lebhaften Markt, der noch mehrere Jahre anhalten dürfte.
3.4 Integrationsmodelle und Werthebel
Die Erfahrung der bisherigen Plattformen zeigt, dass Wertsteigerung im Ingenieurwesen weniger über Kostensynergien als über Prozess- und Technologieintegration erfolgt.
Zentrale Werthebel:
1. Digitalisierung & Standardisierung
- Einführung einheitlicher ERP- und BIM-Systeme.
- Zentralisierung von Ausschreibungs-, Controlling- und HR-Prozessen.
- Skaleneffekte in Einkauf und Softwarelizenzen.
2. Employer Branding & Recruiting
- Aufbau gemeinsamer Akademien, Traineeprogramme und Arbeitgebermarken.
- Nutzung zentraler HR-Tech-Lösungen (z. B. digitale Onboarding-Tools).
3. Markenarchitektur & Marktauftritt
- Plattformen treten zunehmend unter einer einheitlichen Dachmarke auf, um Ausschreibungsfähigkeit bei großen Projekten zu erreichen.
4. Nachfolge & Beteiligungsmodelle
- Unternehmer erhalten häufig 20–40 % Re-Investmentanteile, um Managementkontinuität zu sichern.
- Kombination aus Cash-Exit und langfristiger Beteiligung ist Standard.
5. ESG- und Energiekompetenz
- Integration von Nachhaltigkeits-, Zertifizierungs- und Energieeffizienz-Teams als Differenzierungsmerkmal in öffentlichen Ausschreibungen.
Diese Modelle schaffen nachhaltige Wertschöpfung, da sie strukturelle Schwächen einzelner Büros – Personalmangel, fehlende IT, fehlende Nachfolge – in Gruppenstärke umwandeln.
3.5 Perspektive für mittelständische Unternehmer
Für Eigentümer mittelständischer Ingenieurbüros eröffnen sich in dieser Marktlage drei zentrale strategische Optionen:
1. Verkauf an eine Plattform (Buy-Side-Konsolidierung)
- Schneller Kapitalzugang, geordnete Nachfolge, Beteiligung an zukünftiger Wertsteigerung.
- Ideal für Büros mit stabiler Projektpipeline, aber begrenzten Skalierungsressourcen.
2. Kooperation oder Zusammenschluss auf Augenhöhe
- Zusammenschluss mehrerer gleichrangiger Büros, um gemeinsam als „Mini-Plattform“ aufzutreten.
- Attraktiv, um auf Investorenniveau verhandeln zu können.
3. Eigene Buy-and-Build-Strategie (Sell-Side-Konsolidierung)
- Für wachstumsorientierte Unternehmer mit Expansionsambition.
- Relevante Faktoren: Eigenkapitalbasis, Managementkapazität und klare strategische Positionierung (z. B. TGA-Spezialist oder Generalplaner).
Unabhängig vom gewählten Weg gilt: Vorbereitung ist entscheidend. Ein sauberer Jahresabschluss, belastbare KPIs (EBITDA-Quote, Auslastung, Umsatz pro Mitarbeiter) und dokumentierte Prozesse sind Voraussetzung für attraktive Bewertungen.
3.6 Ausblick: Professionalisierung als neue Währung
Die Konsolidierung der Ingenieurbüros im DACH-Raum steht erst am Anfang. Branchenexperten erwarten, dass in den nächsten fünf Jahren 20–30 % der mittelgroßen Büros in Gruppenstrukturen integriert sein werden.
Die künftigen Marktführer werden jene sein, die
- professionelle Strukturen mit unternehmerischer Kultur verbinden,
- Digitalisierung aktiv gestalten,
- und strategisch mit Kapital arbeiten, statt passiv auf Nachfolger zu warten.
Für Unternehmer, die jetzt handeln, bietet diese Phase außergewöhnliche Chancen:
Die Kombination aus stabiler Nachfrage, politischen Investitionsprogrammen, hohem Investoreninteresse und begrenztem Angebot an qualifizierten Targets schafft ein Marktfenster nur wenige Jahre offen bleiben wird.
4. Bewertungslogik und Deal-Strukturen
4.1 Grundprinzipien der Unternehmensbewertung im Ingenieurwesen
Die Bewertung von Ingenieur- und Planungsbüros folgt grundsätzlich den Regeln des klassischen Ertragswerts bzw. Multiplikatorverfahrens (EBITDA-Multiple). Dennoch gibt es branchenspezifische Besonderheiten, die in kaum einem anderen Sektor so ausgeprägt sind:
- der projektbezogene Charakter der Umsätze,
- die Abhängigkeit von Schlüsselpersonen,
- und der hohe Einfluss von Prozessreife und Digitalisierung auf Skalierbarkeit und Margen.
Investoren bewerten Ingenieurbüros daher weniger nach ihrer Vergangenheit, sondern nach ihrem Reifegrad und Zukunftsfähigkeit. Der entscheidende Bewertungsfaktor lautet: „Wie stabil und reproduzierbar ist das Ertragsniveau?“
Ein Ingenieurbüro mit klaren Prozessen, starker zweiter Führungsebene, hoher IT-Integration und breiter Kundenbasis erzielt in der Regel 1–2 Bewertungsmultiples mehr als ein ähnlich profitables, aber stärker personenbezogenes Büro.
4.2 Aktuelle Bewertungsbandbreiten (DACH, 2025)
Auf Basis von Marktanalysen, PE-Transaktionen und Bewertungsstudien ergibt sich für Ingenieurbüros in der DACH-Region aktuell folgendes Bild:
Diese Multiples spiegeln den Stand Q3/2025 wider. Der Markt ist jedoch selektiv: Top-Bewertungen werden ausschließlich für digital reife, wachstumsfähige und nachfolgeklare Unternehmen gezahlt.
4.3 Werttreiber im Ingenieurwesen
1. Digitalisierung & Prozessreife
Der Digitalisierungsgrad ist der wichtigste Hebel für eine Premiumbewertung.
Investoren achten insbesondere auf:
- BIM-Kompetenz (Building Information Modeling)
- Nutzung digitaler Tools für Projektmanagement, Zeiterfassung und Reporting
- Schnittstellen zu Kundenportalen und Förderplattformen
- IT-Sicherheit & Cloudfähigkeit (Voraussetzung für öffentliche Projekte)
Büros, die BIM-Prozesse standardisiert implementiert haben, erzielen bis zu 20 % höhere EBITDA-Margen und gelten als deutlich leichter integrierbar in Plattformstrukturen.
2. Umsatzqualität & Auftragsmix
Wichtig ist nicht die Höhe, sondern die Planbarkeit der Umsätze. Ein hoher Anteil wiederkehrender Projekte mit öffentlichen oder institutionellen Auftraggebern reduziert das Risiko.
Investoren bevorzugen:
- Langjährige Rahmenverträge mit Kommunen oder Energieversorgern
- Wiederkehrende Prüf- und Instandhaltungsaufträge
- Geringe Abhängigkeit von Einzelkunden (kein Kunde >20 % Umsatzanteil)
3. Management & Nachfolge
Ein Büro ohne klar geregelte Nachfolge ist für Investoren risikobehaftet. Daher steigen Bewertungen deutlich, wenn:
- eine zweite Führungsebene vorhanden ist,
- Know-how über Systeme und Prozesse verteilt ist,
- der Gründer noch 2–3 Jahre als Beirat oder Geschäftsführer zur Verfügung steht.
Fehlende Nachfolge kann dagegen 1–1,5 Multiplepunkte kosten.
4. Spezialisierung & ESG-Kompetenz
Ingenieurbüros mit Kompetenzen in Energieeffizienz, Nachhaltigkeitszertifizierung (DGNB, LEED) oder Infrastrukturplanung genießen strukturelle Nachfragevorteile. Die Kombination aus ESG-Fokus und technischer Tiefe (z. B. TGA-Optimierung, CO₂-Bilanzierung) steigert sowohl den Unternehmenswert als auch die Exit-Attraktivität für strategische Käufer.
5. Marge & Skalierbarkeit
Die typische EBITDA-Marge im Ingenieurwesen liegt zwischen 10 – 15 %. Ein überdurchschnittliches Margenprofil deutet auf effiziente Abläufe und Digitalreife hin.
Investoren achten insbesondere auf:
- Umsatz pro Mitarbeiter (> €130.000 = Benchmark für Effizienz),
- geringe Overhead-Quote (< 25 %),
- stabile Auslastung (> 85 %).
4.5 Earn-Outs, Roll-Overs und Management-Beteiligung
Fast alle aktuellen Transaktionen im Ingenieurwesen beinhalten variable Komponenten.
Typische Modelle:
- Earn-Out: Verkäufer erhält einen Teil des Kaufpreises (10–30 %) abhängig von künftiger Umsatz- oder Ergebnisentwicklung über 2–3 Jahre.
- Roll-Over: Verkäufer reinvestiert 20–40 % des Verkaufserlöses in die Holdingstruktur des Käufers.
- Management-Beteiligung: Schlüsselpersonen erhalten virtuelle Anteile oder Beteiligungsprogramme, um Kontinuität zu sichern.
Für Investoren ist diese Struktur attraktiv, da sie Bindung und Anreiz für das Management schafft. Für Unternehmer bietet sie die Möglichkeit, am Wachstum der Plattform zu partizipieren, also vom „zweiten Exit“ zu profitieren.
4.6 Bewertungsprozesse und Transaktionsvorbereitung
Ein professionell geführter Verkaufsprozess steigert den Unternehmenswert signifikant.
Wichtige Schritte:
- Financial Readiness: Bereinigung der Bilanz, saubere EBITDA-Darstellung, Nachweis von wiederkehrenden Erträgen.
- Commercial Readiness: Darstellung des USP – Spezialisierung, Referenzen, Kundenstruktur, ESG-Kompetenz.
- Organisational Readiness: Nachweis einer stabilen zweiten Führungsebene, strukturierter Prozesse, dokumentierter IT-Systeme.
- Vendor Due Diligence: Eigene Vorprüfung zur Vorbereitung auf Investorenfragen.
Je besser diese Faktoren vorbereitet sind, desto geringer ist der Risikoabschlag im Bewertungsprozess – und desto höher fällt das Multiple aus.
4.7 Fazit: Wert entsteht durch Zukunftsfähigkeit
Die Bewertung von Ingenieurbüros hängt weniger von der Vergangenheit als von ihrer Fähigkeit zur Zukunftsgestaltung ab. Digitalisierung, ESG, Nachfolge und Professionalisierung sind die vier Werttreiber der kommenden Jahre.
Unternehmen, die diese Themen aktiv adressieren, erzielen deutliche Bewertungsprämien und profitieren von einem Marktumfeld, das so günstig ist wie selten zuvor: hohe Investorennachfrage, staatliche Investitionsprogramme und ein struktureller Generationenwechsel.
5. Ausblick & Handlungsempfehlungen für Unternehmer
5.1 Der Ingenieurmarkt steht vor einer Neuordnung
Die Ingenieurbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz befindet sich an einem Wendepunkt. Die strukturellen Treiber – Digitalisierung, ESG-Regulierung, Fachkräftemangel und Nachfolgebedarf – werden das Marktbild in den nächsten fünf Jahren grundlegend verändern.
Wo bisher zehntausende Einzelbüros nebeneinander existierten, entstehen zunehmend professionelle Unternehmensverbünde, die mit einheitlichen Marken, zentralen Prozessen und klaren Wachstumsstrategien auftreten.
Dieses Phänomen lässt sich in Echtzeit beobachten: Plattformen wie Encoviva, Orara, Treysta oder Alva Capital zeigen, dass das klassische Ingenieurbüro vom reinen Dienstleister zum skalierbaren Technologie- und Planungsunternehmen wird.
Der Wandel ist unumkehrbar – und er schafft nicht nur Herausforderungen, sondern vor allem Chancen: Unternehmer, die jetzt handeln, können ihre Marktposition aktiv gestalten, statt auf Konsolidierung zu reagieren.
5.2 Drei strategische Handlungsoptionen
Option 1: Partnerschaft oder Verkauf an eine Plattform
Für viele Unternehmer bietet der Verkauf oder Teilverkauf an eine wachsende Gruppe die beste Balance zwischen Sicherheit, Kontinuität und Zukunftsperspektive.
Typische Vorteile:
- Geordnete Nachfolge und Sicherung der Mitarbeiterbasis,
- Zugang zu Kapital für Digitalisierung, Wachstum und Recruiting,
- Möglichkeit, über Re-Investments an der weiteren Wertsteigerung zu partizipieren,
- Professionalisierung der Strukturen durch zentrale Ressourcen (HR, IT, Controlling).
Voraussetzung ist jedoch eine gute Vorbereitung: klare Finanzdaten, dokumentierte Prozesse, definierte Nachfolge. Wer diese Grundlagen schafft, erzielt überdurchschnittliche Bewertungen.
Option 2: Zusammenschluss auf Augenhöhe
Eine Alternative zur Investoreneinbindung ist der Zusammenschluss mehrerer Mittelständler, die sich zu einer gemeinsamen Holding oder Partnerschaft zusammenschließen.
Dieses Modell („Mittelstands-Buy-and-Build von innen“) bietet:
- Größere Ausschreibungsfähigkeit,
- Gemeinsame Nutzung von BIM-Systemen und IT,
- Bessere Mitarbeiterbindung durch breiteres Karriereangebot,
- Höhere Verhandlungsmacht gegenüber Auftraggebern und Banken.
Solche Allianzen sind besonders attraktiv für Ingenieurbüros mit regionaler Nähe oder komplementären Kompetenzen (z. B. Statik + TGA + Projektsteuerung). Wichtig ist eine klare Governance, damit Entscheidungsprozesse effizient bleiben.
Option 3: Eigene Buy-and-Build-Strategie
Unternehmer mit Wachstumskapital und Ambition können selbst zum Konsolidierer werden. Mit gezielten Zukäufen regionaler Spezialisten lässt sich in kurzer Zeit eine schlagkräftige Unternehmensgruppe aufbauen. Erfolgsfaktoren sind:
- Fokus auf definierte Kompetenzfelder (z. B. ESG-Sanierung, TGA, Infrastruktur),
- professionelles M&A-Setup mit rechtlicher und finanzieller Begleitung,
- Integrationsteam, das Prozesse, Marken und IT vereinheitlicht.
Viele Family Offices oder institutionelle Investoren beteiligen sich heute auch an Co-Sponsor-Modellen, bei denen der Unternehmer die operative Führung behält, während das Family Office Kapital und Deal-Erfahrung einbringt.
5.3 Erfolgsfaktoren bei Nachfolge und Verkauf
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Exit liegt selten im Marktumfeld – sondern in der Vorbereitung.
Fünf zentrale Hebel für Unternehmer:
- Frühzeitige Planung (3–5 Jahre vor Exit): Nachfolge, Managementstruktur und Prozessorganisation aufbauen.
- Transparente Finanz- und Leistungsdaten: Bereinigtes EBITDA, Umsatz pro Mitarbeiter, Auftragsbestand und Pipeline dokumentieren.
- Digitalisierung & ESG als Werthebel begreifen: BIM-Reife, Energieeffizienzberatung, Nachhaltigkeitszertifizierungen systematisch ausbauen.
- Kommunikation und Kultur: Mitarbeiter früh einbinden, Vertrauen schaffen, Nachfolge offen ansprechen.
- Strukturierte Beratung und Prozessführung: Begleitung durch spezialisierte M&A-Berater, Steuerexperten und Juristen, um Deal-Struktur, Steueroptimierung und Kommunikation professionell zu steuern.
5.4 Perspektive: Von der Ingenieurtradition zur Zukunftsbranche
Die Ingenieurbranche war lange das Rückgrat der Bau- und Infrastrukturentwicklung – nun wird sie selbst zu einem Transformationsmotor. Durch den technologischen Wandel, staatliche Investitionsprogramme und das steigende ESG-Bewusstsein wächst der Bedarf an planungs- und prozessstarken Partnern.
Die Zukunft gehört jenen Ingenieurbüros, die drei Eigenschaften vereinen:
- Technologische Kompetenz – Nutzung digitaler Tools und Daten.
- Unternehmerische Weitsicht – Aufbau skalierbarer Strukturen.
- Kulturelle Stärke – Bewahrung der Ingenieuridentität trotz Wachstum.
In fünf Jahren wird der Markt anders aussehen:
- 20–30 % der mittelgroßen Büros werden Teil größerer Gruppen sein.
- Plattformen mit 300–1.000 Mitarbeitern werden die Großprojekte dominieren.
- Die Bewertungsspannen werden sich stärker nach Professionalität als nach Größe unterscheiden.

Fazit: Jetzt ist die Zeit für strategisches Handeln
Der Ingenieurmarkt steht vor seiner größten Strukturveränderung seit Jahrzehnten. Stabile Nachfrage, staatliche Investitionsprogramme und Kapitalinteresse treffen auf eine alternde Eigentümerstruktur – eine Konstellation, die es so in dieser Dichte noch nie gegeben hat.Für Unternehmer bedeutet das: Wer heute vorbereitet ist, hat die Wahl. Zwischen Verkauf, Partnerschaft oder eigener Expansion – und damit die Chance, aktiv zu gestalten, statt reagieren zu müssen.Die kommenden Jahre werden entscheiden, wer die neue Generation des Ingenieurwesens prägt. Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Nachfolge sind dabei keine Risiken, sondern Eintrittskarten in eine neue Ära des Ingenieurunternehmertums.
1. Markt- & Strukturtrends
Bundesingenieurkammer (BIngK): Wirtschaftliche Lage der Ingenieure in Deutschland 2024
Statistisches Bundesamt: Baugewerbliche Umsätze und Beschäftigung 2023–2025
Lünendonk & Hossenfelder GmbH: Marktsegment Architektur- und Ingenieurdienstleistungen 2024
ZIA & Hauptverband der Deutschen Bauindustrie: Bauprognose 2025 – Entwicklung der Planungsleistungen im Hoch- und Tiefbau
Verband Beratender Ingenieure (VBI): Jahresbericht 2024 – Fachkräftemangel und Strukturwandel
Deloitte: European Engineering & Infrastructure Outlook 2025
Roland Berger: Future of Construction Engineering – Digitalisation & ESG as Value Drivers
2. M&A-Aktivität & Plattformbildungen
Greenpeak Partners: Encoviva Group – Strategy & Portfolio Overview (Press Release, 2024)
AUCTUS Capital Partners: Orara Group – Plattform für Ingenieurdienstleistungen im Hochbau (Deal Announcement, 2024)
Treysta Group: Corporate Presentation 2025 – Infrastructure Engineering Consolidation
Alva Capital Partners: Launch Release – Buy-and-Build Platform for TGA and Building Engineering (2025)
Mergermarket Database (Abruf Juli 2025): Engineering & Infrastructure Services Transactions – DACH Region 2023–2025
Pitchbook: Private Equity Engineering & Construction Report Q2 2025
InfraJournal Europe: Private Equity in Technical Services – Consolidation Wave 2025
Capital Finance / FINANCE Magazin (2025): Buy-and-Build-Trend erreicht Ingenieurbüros – Strategien von Encoviva, Orara & Treysta
Handelsblatt: Greenpeak baut mit Encoviva eine Ingenieurgruppe im Hochbau (Februar 2025)
Baunetz: Neue Player am Markt – PE-finanzierte Ingenieurgruppen übernehmen Mittelständler (Mai 2025)
3. Bewertung & Finanzierung
Argos Wityu / Epsilon Research: Argos Mid-Market Index Q2 2025
Kleeberg & Partner: Jahresrückblick Unternehmensbewertung 2024 – Mittelstand im Zinswandel
Rödl & Partner: M&A im Mittelstand 2025 – Bewertungs- und Finanzierungsumfeld
PwC: Valuation Multiples in European Engineering and Infrastructure Services (2024/2025)
Lincoln International: Mid-Market Engineering Services Transactions Report 2024
EY-Parthenon: European Construction Engineering Consolidation Trends 2024
Bundesbank: Zinsentwicklung und Investitionsbedingungen Q3 2025
Deutsche Beteiligungs AG (DBAG): Marktausblick für technische Dienstleistungen 2025
Preqin: Private Capital in Technical Services 2025 – Europe Focus
4. Regulatorik & öffentliche Investitionsprogramme
Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“ (BMWK, Stand Juli 2025) – enthält Mittel zur Gebäudesanierung, Energieeffizienz und Wasserstoffinfrastruktur
Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV): Infrastrukturausgaben 2025 – Sondervermögen und Bundeshaushaltsposten – Investitionen i.H.v. 22 Mrd. € (davon 10,5 Mrd. € Schiene, 3,4 Mrd. € Straße, 2,1 Mrd. € Wasserbau)
Deutscher Bundestag – Haushaltsausschuss (Beschluss Mai 2025): Verwendung des Sondervermögens Infrastruktur
ÖBB Infrastruktur AG: Rahmenplan 2024–2029 (21 Mrd. € Investitionen)
Bundesamt für Raumentwicklung Schweiz (ARE): Infrastrukturprogramm 2025–2028 – Schiene, Wasser, Energie (16 Mrd. CHF)
EU-Kommission: Recast of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD, 2024)
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Digitalisierungsstrategie BIM Deutschland – Umsetzung bis 2027
HOAI-Novelle 2025 (Entwurf): Anpassungen an EU-Recht, Digitalisierung und flexible Preisgestaltung
5. Presse & ergänzende Branchenberichte
Handelsblatt Research Institute: Private Equity investiert in Planung und Bau – Marktüberblick 2025
Capital / WirtschaftsWoche: Neue Kapitalgeber im Ingenieurwesen: Der Mittelstand wird zum Ziel von Buy-and-Build-Strategien
Bauingenieur.de / Baunetz Wissen: Digitalisierung, BIM und Fachkräftemangel: Die großen Herausforderungen für Ingenieurbüros
manager magazin: Engineering wird Investmentthema – von TGA bis Infrastruktur
mandaco.de: Deal-Tracker Bau & Technik Q3 2025
FINANCE Magazin: Private Equity rollt Ingenieurwesen auf – aktuelle Deals und Bewertungen (August 2025)

.svg.avif)