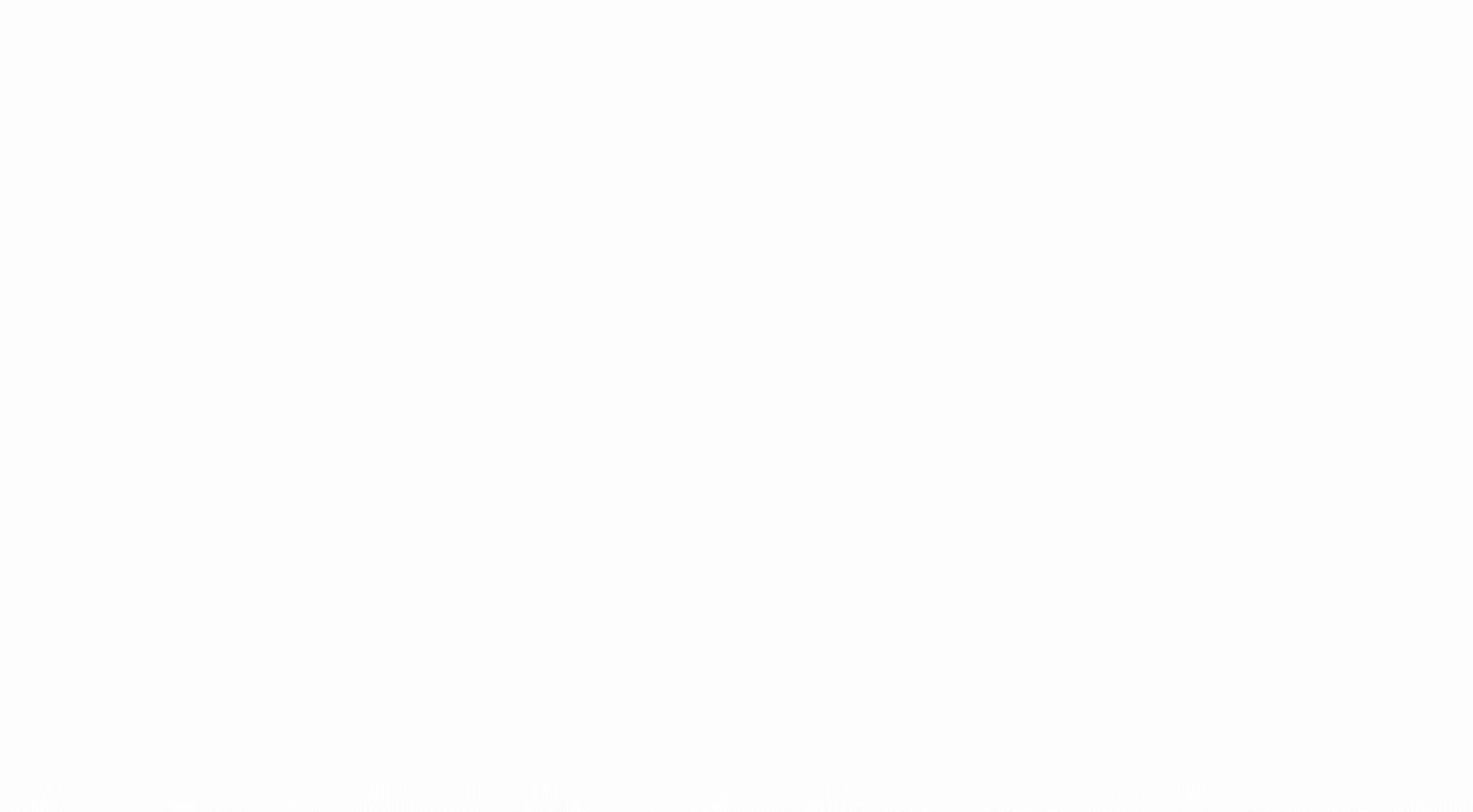Die Finanzindustrie steht an einem strukturellen Umbruch. Steigende regulatorische Anforderungen, der wachsende Anteil illiquider und alternativer Anlagen sowie zunehmender Margen- und Effizienzdruck verändern Geschäftsmodelle in Banken, Asset Management und Versicherungen grundlegend. Parallel dazu wird Technologie und Digitalisierung vom reinen Effizienzhebel zum integralen Bestandteil regulatorischer Konformität.
Genau an der Schnittstelle von Financial Services, RegTech (Regulatory Technology) und unabhängigen Bewertungs- und Risikodienstleistungen entsteht ein Markt, der aus M&A-Perspektive hochattraktiv ist. Regulierung wirkt dabei nicht nur als Kostenblock, sondern als Wachstumsmotor: Neue und verschärfte Regelwerke erhöhen die Komplexität und machen belastbare, standardisierte Bewertungs- und Risikoprozesse zur Pflicht. Unabhängige, auditfähige Anbieter mit entsprechender Tiefe werden zur knappen Ressource.
Der Markt ist gleichzeitig stark fragmentiert. Es gibt viele spezialisierte Nischenanbieter, aber nur wenige echte Plattformen. Diese Kombination aus pflichtgetriebener Nachfrage, hohen Eintrittsbarrieren und fragmentiertem Angebot schafft ideale Voraussetzungen für Buy-and-Build-Strategien im RegTech- und Bewertungssegment. Für Unternehmer bedeutet das: Wer regulatorische Tiefe, technologische Skalierbarkeit und einen belastbaren Track Record vereint, wird zum gesuchten Ziel in M&A-Prozessen. Für Investoren eröffnet sich ein strukturell wachsender Markt, in dem Plattformmodelle überdurchschnittliches Wertschöpfungspotenzial besitzen.
M&A in Financial Services & RegTech: Vom Markttrend zur Kernfrage
Finanzmärkte im strukturellen Wandel
Die globalen Finanzmärkte wachsen weiter, verändern dabei aber ihre Struktur. Neben klassischen liquiden Anlagen gewinnen illiquide und alternative Assetklassen - etwa Infrastruktur, Private Debt oder Private Equity - spürbar an Bedeutung. Gleichzeitig entstehen neue Produktformen wie digitale Wertpapiere, thematische oder ESG-orientierte Strategien und komplexe strukturierte Produkte.
Mit dieser Vielfalt steigen die Anforderungen an Bewertung, Risiko- und Datenmanagement. Die Branche bewegt sich von einer vergleichsweise homogenen Produktwelt hin zu einem Ökosystem, in dem unterschiedliche Assetklassen, Laufzeiten, Liquiditätsprofile und Risikoträger miteinander kombiniert werden.
Regulatorische Verdichtung und operative Überforderung
Auf diese zunehmende Komplexität treffen immer dichtere und granularere Regulierungspakete. Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden schreiben detailliert vor, wie Risiken zu messen, Vermögenswerte zu bewerten, Daten zu verarbeiten und Berichte zu erstellen sind. Regelwerke wie PRIIPs, MiFID II, Basel III/FRTB, AIFMD/KAGB, Solvency II, IFRS 13/9/17, DORA, ESG-Regime und MiCA greifen tief in die Prozesse der Institute ein.
Diese Vorgaben sind nicht einmalige Projekte, sondern erzeugen einen permanenten Anpassungsdruck. Viele Häuser stoßen mit internen Teams und Systemen an Grenzen, wenn sie gleichzeitig neue Produkte entwickeln, Kosten senken, digitalisieren und regulatorische Anforderungen erfüllen sollen. Besonders anspruchsvoll wird es dort, wo illiquide oder neue Assetklassen in großer Anzahl bewertet und überwacht werden müssen. Externe Spezialisten werden damit vom “nice-to-have” zur Notwendigkeit.
Was heißt das für Unternehmer und Investoren?
Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage: Wie können Unternehmer in RegTech, Bewertungs- und Risikodienstleistungen sowie Investoren diesen regulatorisch getriebenen Wandel nutzen, um Plattformen aufzubauen, Wachstum zu sichern und attraktive M&A-Optionen zu realisieren?
Regulierung als Motor für RegTech- und Bewertungsplattformen
Die Antwort lautet: Regulierung ist kein reines Compliance-Thema, sondern ein strategischer Wachstumshebel. Sie erzeugt einen strukturellen Nachfrageüberhang nach unabhängigen Bewertungs- und RegTech-Lösungen, erhöht die Eintrittsbarrieren und begünstigt Anbieter, die Methodenkompetenz, Technologie und Auditfähigkeit kombinieren.
Unternehmen, die sich klar als Lösungsträger für konkrete regulatorische Pain Points positionieren und sich technologisch als Plattformkern eignen, werden zu bevorzugten Targets in M&A-Prozessen. Gleichzeitig entsteht für Investoren ein klares Spielfeld für Buy-and-Build-Strategien: Fragmentierte Spezialkapazitäten lassen sich zu integrierten, skalierbaren RegTech- und Bewertungsplattformen bündeln.
Marktanalyse Financial Services: Drei Wertschöpfungsstränge
Aus Perspektive von Bewertungs- und Risikodienstleistungen lassen sich drei Wertschöpfungsstränge unterscheiden, die sich jeweils anders entwickeln, aber alle stark von regulatorischen Anforderungen geprägt sind.Im Bereich der liquiden Assetklassen - also etwa Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs oder standardisierte Derivate - steht der hohe Grad an Standardisierung im Vordergrund. Hier geht es vor allem darum, große Volumina effizient zu verarbeiten, konsistente Marktdaten zu nutzen und transparente Risiko- und Kosteninformationen bereitzustellen. Vorgaben aus MiFID II und PRIIPs zwingen Institute dazu, Kennzahlen, Szenarien und Produktinformationen vergleichbar und verständlich auszuweisen. Hier entsteht eine wachsender Bedarf nach standardisierten Bewertungs- und
Analyseprozessen.
Deutlich komplexer präsentiert sich der Bereich der illiquiden und alternativen Assetklassen. Infrastrukturprojekte, Private Equity und Private Debt, Immobilien oder strukturierte Spezialfinanzierungen lassen sich nicht einfach aus Marktpreisen ableiten. Sie erfordern modellbasierte, häufig individuelle Bewertungsansätze, bei denen Annahmen, Parameter und Datenquellen transparent dokumentiert werden müssen. AIFMD/KAGB, Solvency II und IFRS 13 verlangen für diese Vermögenswerte regelmäßige, nachvollziehbare und oft auch unabhängige Bewertungen. Damit entstehen wiederkehrende Bedarfe an Spezial-Know-how und externen Bewertungsservices.
Der dritte Strang umfasst risikoorientierte Bewertungs- und Managementlösungen. Hier geht es darum, Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und Gegenparteirisiken, aber auch operationelle Risiken wie Cyberangriffe, prozessual und modellbasiert zu erfassen. Volatile Märkte und geopolitische Spannungen verstärken den Druck, Szenarien durchzuspielen, Stresstests durchzuführen und die Ergebnisse regulatorisch belastbar zu dokumentieren. Moderne Anbieter nutzen hierfür algorithmusgestützte Prognosen, automatisierte Datenfeeds und integrierte Risikoplattformen. Auch hier treibt Regulierung - etwa Basel III/FRTB oder DORA - die Anforderungen an Tiefe, Frequenz und Dokumentation stetig nach oben.
Ohne robuste, nachvollziehbare und technologisch eingebettete Bewertungs- und Risikomodelle lassen sich die regulatorischen Anforderungen künftig kaum noch erfüllen.
Regulierung als Megatrend: Wie neue Standards die Spielregeln verändern
Regulatorik, ESG und Technologie
Die aktuelle Marktlage zeigt deutlich, dass drei Treiber untrennbar zusammenwirken: Regulierung, Nachhaltigkeit und Technologie.
Auf der regulatorischen Seite wächst der Umfang an Vorschriften kontinuierlich. Neue Gesetze kommen hinzu, bestehende werden verfeinert und verschärft. Gleichzeitig wird Nachhaltigkeit regulatorisch verankert. ESG-Kriterien sind nicht mehr freiwillige Marketinglabel, sondern Bestandteil von Produktregeln, Risikoanalysen und Offenlegungsverpflichtungen. Technologie schließlich ist nicht nur Mittel zur Effizienzsteigerung, sondern selbst Gegenstand der Regulierung: IT-Sicherheit, Cyberresilienz, Datenqualität und Prozessdokumentation sind explizite Prüffelder geworden.
Wer heute compliant sein will, benötigt daher digitale, integrierte Bewertungs- und Risikolösungen, die ESG-Daten verarbeiten, regulatorische Vorgaben abbilden und auf einer resilienten technologischen Grundlage laufen. Genau hier positionieren sich RegTech- und spezialisierte Bewertungsanbieter.
Zentrale regulatorische Treiber im Überblick
Besonders prägend ist das Zusammenspiel mehrerer Regelwerke, die unterschiedliche Teile der Wertschöpfung adressieren, in ihrer Wirkung aber stark miteinander verzahnt sind. PRIIPs und MiFID II steigern die Anforderungen an Transparenz und Standardisierung von Produktinformationen. Sie definieren, welche Risiko-, Kosten- und Performanceinformationen ein Anleger in welcher Form erhalten muss. Das zwingt Institute dazu, Bewertungslogiken und Risikomodelle so aufzusetzen, dass sie konsistente Kennzahlen liefern, die sich standardisiert ausgeben und vergleichen lassen.
Basel III und die finale Umsetzung des Fundamental Review of the Trading Book erhöhen die Anforderungen an die Modellierung von Markt- und Kreditrisiken. Sie definieren granular, wie Risiken zu messen sind und wie viel Eigenkapital zur Unterlegung vorgehalten werden muss. Das erhöht die Bedeutung validierter Risikomodelle, belastbarer Daten und regelmäßiger Modellprüfungen deutlich.
AIFMD und KAGB sorgen im Fondsgeschäft dafür, dass die Bewertung insbesondere illiquider Assets nicht dem freien Ermessen überlassen bleibt. Sie schreiben regelmäßige, nachvollziehbare und in vielen Fällen unabhängige Bewertungen vor. Ähnliche Wirkungen entfaltet Solvency II auf Seiten der Versicherer. Uniforme oder grobe Schätzmethoden reichen nicht mehr aus. Gefordert sind methodisch saubere und dokumentierte Bewertungsansätze.
Die IFRS-Regelungen - vor allem IFRS 13, IFRS 9 und IFRS 17 - ziehen bilanzielle Leitplanken ein. Sie definieren, wie Fair-Value-Bewertungen auszusehen haben, wie erwartete Kreditausfälle zu berücksichtigen sind und wie langfristige Verpflichtungen anzusetzen sind. Diese Vorgaben greifen direkt in Bewertungsmodelle und Risikoprognosen ein und machen sie zu einem zentralen Gegenstand externer Prüfung.
Hinzu kommen die ESG-Regulierung und die EU-Taxonomie, die Nachhaltigkeitsaspekte in Produkte, Portfolios und Berichte integrieren, sowie MiCA als Rahmen für Krypto- und digitale Assets. Schließlich schafft DORA einen EU-weiten Standard für digitale Resilienz. Institute müssen nachweisen, dass ihre IT-Landschaft, inklusive der Systeme, die Bewertungen und Risikoanalysen liefern, robust, kontrolliert und dokumentiert ist.
Jedes dieser Regelwerke adressiert ein anderes Segment, gemeinsam erhöhen sie jedoch die Anforderungen an Tiefe, Verlässlichkeit und Automatisierung von Bewertungs- und Risikoprozessen massiv.
Von der Vorschrift zur Wachstumschance
Entscheidend ist, dass diese Vorschriften nicht nur zusätzliche Arbeit erzeugen, sondern klar identifizierbare Wachstumschancen schaffen. Viele regulatorische Anforderungen lassen sich nur mit spezialisierten Methoden, validierten Modellen und skalierbarer Technologie effizient erfüllen.
Wo PRIIPs und MiFID II standardisierte Kennzahlen verlangen, entsteht Bedarf nach zentralen Bewertungs-Engines und Reporting-Services. Wo Basel III/FRTB detaillierte Marktrisiko-Modelle fordert, braucht es externe Validierung, Modellbibliotheken und spezialisierte Risiko-Services. Wo AIFMD/KAGB und Solvency II unabhängige Bewertungen vorschreiben, werden Drittanbieter mit entsprechender Expertise faktisch in den Kern der Prozessketten integriert. Und wo ESG- und Digital-Asset-Regelwerke neue Bewertungslogiken und Datenquellen erzwingen, werden spezialisierte RegTech- und Bewertungsplattformen zu unverzichtbaren Partnern.
Regulierung wirkt damit wie eine strukturelle Anschubfinanzierung für einen Markt, in dem die Nachfrage nicht durch Konjunktur, sondern durch Pflicht entsteht.
Externe Beratung und Bewertung als operativer Standard
Ein zentraler Effekt dieser Entwicklung ist der Übergang von der punktuellen zur dauerhaften Einbindung externer Bewertungen. Was früher vor allem bei besonders komplexen oder konfliktträchtigen Assets zum Einsatz kam, entwickelt sich heute zum Standard für gesamte Assetklassen oder Produkte.
Die Komplexität der Rahmenbedingungen stärkt die strategische Rolle unabhängiger Bewertungsprozesse. Aufsichtsbehörden und Prüfer erwarten, dass Methoden nachvollziehbar dokumentiert, Annahmen klar begründet und Ergebnisse konsistent reproduzierbar sind. Externe Anbieter, die über standardisierte Verfahren, skalierbare Technologie und lückenlose Dokumentation verfügen, werden damit zu einem integralen Bestandteil von Governance und Kontrolle.
Um dieser Rolle gerecht zu werden, müssen externe Bewertungen tief in die Systeme und Prozesse der Kunden eingebunden sein. Es reicht nicht, einmal im Jahr ein Gutachten zu liefern. Gefragt sind wiederkehrende, automatisierte Bewertungs- und Validierungsprozesse, die sich nahtlos in Risikoreports, Management-Information und aufsichtsrechtliches Reporting einfügen.
Illiquide Assets als regulatorischer Brennpunkt
Besonders deutlich zeigt sich die Notwendigkeit spezialisierter Bewertungsanbieter bei illiquiden und strukturierten Vermögenswerten. Hier gibt es häufig keine Marktpreise, auf die man zurückgreifen könnte. Stattdessen müssen Modelle entwickelt werden, die künftige Cashflows, Ausfallrisiken, Sicherheiten und Szenarien abbilden.
Regulatorische Rahmen wie IFRS 13 und AIFMD verlangen, dass diese Modelle nachvollziehbar, marktgerecht und konsistent angewendet werden. Gleichzeitig steigt die Erwartung, dass Dritte - sei es Aufsicht, Prüfer oder Investoren - die Bewertungslogik nachvollziehen und hinterfragen können. In der Praxis führt das dazu, dass unabhängige Bewertungsanbieter mit spezieller Expertise für illiquide Assetklassen permanent eingebunden werden.
Für diese Anbieter ergeben sich daraus gleich mehrere Vorteile. Sie bewegen sich in einem Segment, in dem die Eintrittsbarrieren hoch sind, weil es sowohl tiefer fachlicher Expertise als auch solider technologischer Infrastruktur bedarf. Und sie agieren in einem Bereich, in dem die Nachfrage nicht aufgeschoben werden kann, weil regulatorische Fristen und Prüfzyklen verbindlich festgelegt sind.
Track Record und Auditfähigkeit als Eintrittskarte
Je dichter die Regulierung, desto wichtiger werden ein belastbarer Track Record und nachgewiesene Auditfähigkeit. Banken, Asset Manager und Versicherer wählen ihre Bewertungs- und RegTech-Partner nicht nur nach Funktionalität, sondern vor allem nach Verlässlichkeit aus.
Langjährige Kundenbeziehungen, erfolgreiche Prüfungen durch Aufsicht und Auditoren sowie dokumentierte Modellvalidierungen werden zu zentralen Auswahlkriterien. Hinzu kommt, dass regulierte Institute selbst strengen KYC-Anforderungen in Richtung ihrer Dienstleister unterliegen. Sie prüfen, mit wem sie zusammenarbeiten, sehr genau.
Für Anbieter ist dieser Aspekt Fluch und Segen zugleich. Er erschwert den Neueinstieg, schützt aber etablierte Player vor Nachahmern. Unternehmen, die ihre Historie, ihre regulatorische Expertise und ihre Prüfungsbilanz aktiv managen und dokumentieren, schaffen damit einen wesentlichen Werttreiber - und eine klare Differenzierung für Ihre Nachfolgeregelung im M&A-Kontext.
RegTech-Markt und Nachfrageprofil im Kontext der Regulierung
Vor diesem Hintergrund ist die Dynamik des RegTech-Marktes leicht zu erklären. Viele Aufgaben, die früher manuell oder mit einfachen Tools erledigt wurden, lassen sich heute nur noch mit spezialisierter Software und integrierten Plattformen effizient abbilden.
KYC- und AML-Prozesse müssen große Datenmengen in Echtzeit verarbeiten, Sanktionslisten aktualisieren, Transaktionen überwachen und Verdachtsmomente dokumentieren. Meldewesen und regulatorisches Reporting werden immer granularer und umfassen neben finanziellen Daten zunehmend nicht-finanzielle Kennzahlen. ESG-Reporting erfordert den Zugriff auf neue Datenquellen, die Bewertung digitaler Assets neue Bewertungslogiken. DORA verschiebt den Fokus zusätzlich auf ICT-Risiken und digitale Resilienz.
Kunden wollen dabei keine Sammlung einzelner Tools mehr verwalten. Sie bevorzugen integrierte Lösungen, die mehrere Anforderungen gleichzeitig abdecken. Der Wunsch geht in Richtung Plattformen, in denen Bewertungs-Engines, Risikomodelle, Compliance-Funktionalitäten und Reporting-Module zusammenlaufen.
Für RegTech- und Bewertungsanbieter bedeutet das, dass sich ihre Rolle vom reinen „Tool-Lieferanten“ hin zum Infrastrukturpartner verändert. Wer sich hier gut positioniert, baut langfristige, wiederkehrende Erträge auf.
Mergers & Acquisitions Landschaft: Konsolidierung unter regulatorischem Druck
Die bereits beobachteten Transaktionen im Markt für Bewertungs- und Risikodienstleistungen spiegeln diese Entwicklung wider. Globale Finanzberater, Infrastrukturanbieter und Softwareplattformen erwerben technologiegestützte Bewertungs- und Analysedienstleister, um ihre Angebote entlang der regulatorischen Wertschöpfungskette zu verbreitern. Private-Equity-Investoren steigen in Risiko-Softwarehäuser ein, um diese zu Wachstums- und Konsolidierungsplattformen auszubauen.
Informations- und Bewertungsdienstleister für Immobilien oder spezialisierte Assetklassen werden in größere Analytik- und Servicing-Plattformen integriert. Portfolio- und Risikomanagementlösungen werden um RegTech-Funktionalitäten erweitert oder durch Zukäufe komplettiert. Die zugrunde liegende Logik ist immer ähnlich: Wer seinen Kunden eine umfassendere, besser integrierte und regulatorisch belastbare Lösung anbieten kann, sichert sich einen Wettbewerbsvorteil.
Für unabhängige RegTech- und Bewertungsanbieter ergibt sich daraus ein attraktives Spannungsfeld. Sie sind einerseits Ziel dieser Konsolidierung, weil sie über Know-how, Technologie und Kundenbeziehungen verfügen. Andererseits können sie selbst - mit Unterstützung von Investoren - als Kern zukünftiger Organisationen fungieren und durch Zukäufe wachsen.
RegTech & Bewertungsdienste als idealer Buy-and-Build-Case
Aus Investorensicht vereint der Sektor mehrere Eigenschaften, die ihn für Buy-and-Build-Strategien besonders geeignet machen. Das Angebot ist fragmentiert. Viele Unternehmen bedienen einzelne Use-Cases, Assetklassen oder Regionen sehr gut, aber nur wenige decken die gesamte regulatorische Wertschöpfungskette ab. Die Nachfrage ist hingegen auf Integration ausgerichtet: Institute möchten möglichst viele Anforderungen - von Bewertung über Risiko bis Compliance - aus einer Hand oder zumindest aus einer eng verzahnten Plattform steuern.
Gleichzeitig sind die Eintrittsbarrieren hoch. Wer eine RegTech- oder Bewertungsplattform aufbauen möchte, benötigt nicht nur Technologie und Kapital, sondern vor allem tiefes regulatorisches Verständnis, etablierte Methoden und belastbare Beziehungen in einem Umfeld, in dem Vertrauen und Reputation entscheidend sind. Genau das spricht dafür, vorhandene Spezialisten zusammenzuführen, statt von Null an zu starten.
Ein typischer Buy-and-Build-Plan beginnt mit einem Kernunternehmen, das über eine klare Positionierung, reife Produkte und einen relevanten Kundenstamm verfügt. Darauf aufbauend werden gezielt Ergänzungen gesucht - etwa Anbieter mit besonderer Expertise in ESG, bestimmte illiquide Assetklassen, spezifische nationale Regimes oder zusätzliche Reporting-Module.
Diese Zukäufe lassen sich in eine gemeinsame Produkt- und Datenarchitektur integrieren. Parallel dazu werden Vertrieb, Marketing und Implementierung professionalisiert, um das wachsende Leistungsangebot in der Breite des Marktes zu platzieren. So entsteht Schritt für Schritt eine Plattform, die es Kunden ermöglicht, regulatorische Anforderungen in großer Tiefe und Breite über eine konsistente Lösung abzudecken.
Strategische Implikationen für Unternehmer
Für Gründer, Gesellschafter und Managementteams im RegTech- und Bewertungsumfeld ergeben sich aus dieser Analyse mehrere strategische Konsequenzen.
Zum einen sollte sich die Verkäuferseite ihre Equity Story konsequent entlang regulatorischer Use-Cases formulieren. Es reicht nicht, von „Bewertung“ oder „Risikomanagement“ im Allgemeinen zu sprechen. Entscheidend ist, klar zu benennen, welche konkreten Vorschriften adressiert werden - etwa, wie AIFMD-Konformität bei illiquiden Fondsportfolios unterstützt wird, wie Solvency-II-Bewertungen effizienter werden oder wie DORA-Anforderungen in Bezug auf Datenqualität und IT-Resilienz erfüllt werden können. Je klarer dieser Bezug, desto leichter fällt es potenziellen Käufern, den strategischen Wert eines Unternehmens zu erkennen.
Zum zweiten lohnt es sich, Bewertungs- und Validierungsleistungen als Produkte zu denken. Wiederkehrende Bewertungszyklen, standardisierte Reportings, modulare Servicepakete und klar definierte Schnittstellen in Kundensysteme sind in der Regel skalierbarer und M&A-tauglicher als rein projektbasierte Einzellösungen. Unternehmen, die in diese Richtung professionalisieren, schaffen eine Grundlage für wachstumsfähige Plattformmodelle.
Zum dritten sollten Unternehmer ihren Track Record aktiv gestalten. Dokumentierte Erfolge in regulierungsintensiven Umfeldern, referenzfähige Kundenprojekte, erfolgreiche Aufsichts- und Auditprüfungen und nachvollziehbare Modellvalidierungen sind im heutigen Umfeld ein wesentlicher Werttreiber. Wer diese Elemente systematisch sammelt, aufbereitet und kommuniziert, verbessert seine Position in Verhandlungen spürbar.
Das bedeutet eine gründlichen Vorbereitung auf den Due-Diligence-Prozess ist entscheidend, insbesondere im Hinblick auf regulatorische Nachweise.
Perspektive der Investoren: Regulierung als Investment-These
Investoren können Regulierung als klare Investment-These nutzen. Jede neue Welle von Vorschriften - ob nun in Richtung Markt- und Kreditrisiko, ESG, digitale Assets oder operative Resilienz - erhöht den Bedarf an spezialisierten Lösungen. Während der Aufwand für Institute steigt, erweitert sich das Spielfeld für Anbieter, die diese Herausforderungen in skalierbare, wiederkehrende Ertragsmodelle übersetzen.
Attraktive Zielunternehmen sind diejenigen, die bereits eine gewisse Plattformreife erreicht haben: eine belastbare Produktbasis, technologiegestützte Prozesse, tief verankerte Kundenbeziehungen und erkennbare Alleinstellungsmerkmale im regulatorischen Kontext. Von dort aus lassen sich durch gezielte Akquisitionen weitere Module, Regionen oder Kundensegmente erschließen.
Wer frühzeitig in solche Kernplattformen einsteigt und eine klare Buy-and-Build-Logik verfolgt, positioniert sich in einem Markt, in dem Wachstum eher durch Regulatorik als durch Konjunkturzyklen getrieben wird. Das schafft - bei guter Ausführung - die Grundlage für attraktive Renditeprofile.

Fazit & Ausblick bis 2030: Ein Jahrzehnt der Konsolidierung
Bis 2030 wird sich die RegTech- und Bewertungslandschaft grundlegend verändern - nicht durch eine plötzliche regulatorische Wende, sondern durch die fortschreitende Professionalisierung und Konsolidierung eines Marktes, der heute noch stark fragmentiert ist. Während die regulatorischen Anforderungen weiter zunehmen und gleichzeitig granularer werden, entsteht ein Umfeld, in dem einzelne Spezialanbieter kaum noch die gesamte Tiefe und Breite der Anforderungen abdecken können. Dadurch werden integrierte Plattformen, die Bewertung, Risiko, Compliance und Reporting verbinden, zum neuen Standard.
Die strukturellen Voraussetzungen dafür sind bereits sichtbar: hohe Eintrittsbarrieren, steigende Anforderungen an Auditfähigkeit und Technologieintegration sowie eine zahlungskräftige, pflichtgetriebene Nachfrage. Für Private-Equity-Investoren ergibt sich daraus eine klare Chance. In den kommenden Jahren werden sich mehrere PE-backed RegTech-Gruppen herausbilden - Plattformen, die durch gezielte Buy-and-Build-Strategien aus spezialisierten Nischenanbietern konsolidierte, skalierbare Einheiten formen. Diese Gruppen werden vor allem dort entstehen, wo regulatorische Tiefe, technologisches Fundament und ein belastbarer Track Record zusammenkommen.
Unternehmer, die ihre Positionierung bereits heute entlang regulatorischer Use Cases schärfen und ihre Leistungen in skalierbaren, auditfähigen Prozessen anbieten, erhöhen ihre Attraktivität in diesem Konsolidierungsumfeld deutlich. Investoren, die frühzeitig klare Plattformlogiken entwickeln und konsequent akquirieren, sichern sich einen Vorteil in einem Markt, der strukturell wächst und in dem Größe, Integrationstiefe und Verlässlichkeit zu zentralen Differenzierungsmerkmalen werden.

.svg.avif)